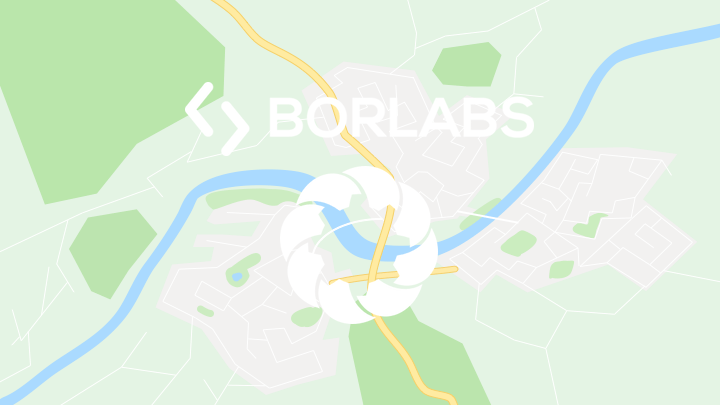Glomerulonephritis
Entzündung der Nierenkörperchen verstehen und erkennen
Die Glomerulonephritis ist eine entzündliche Erkrankung der Nieren, die vor allem die sogenannten Glomeruli – die feinen Gefäßknäuel in den Nierenkörperchen – betrifft. Diese Strukturen spielen eine zentrale Rolle bei der Blutfiltration. Wird ihre Funktion durch eine Entzündung beeinträchtigt, kann das weitreichende Folgen für den gesamten Organismus haben.
Was ist eine Glomerulonephritis?
Der Begriff Glomerulonephritis setzt sich aus den Worten „Glomeruli“ (Nierenkörperchen) und „Nephritis“ (Nierenentzündung) zusammen. Die Glomeruli bestehen aus einem feinen Kapillarnetz, das das Blut filtert und dabei den sogenannten Primärharn bildet. Dieser enthält zunächst Wasser, Salze, Abfallstoffe und kleine Moleküle, jedoch keine Zellen oder größeren Eiweiße.
Kommt es zu einer Entzündung der Glomeruli, wird diese Filterfunktion gestört. In der Folge können unter anderem Eiweiße und Blutbestandteile in den Urin gelangen. Je nach Verlauf und Ursache kann eine Glomerulonephritis akut, chronisch oder schleichend auftreten.
Ursachen und Formen der Glomerulonephritis
Eine Glomerulonephritis kann viele Ursachen haben. Sie wird häufig nach ihrer Entstehung in primäre und sekundäre Formen unterteilt:
1. Primäre Glomerulonephritis
Diese Form tritt isoliert in der Niere auf, ohne dass andere Organe beteiligt sind. Die genauen Ursachen sind oft unklar, es wird jedoch angenommen, dass immunologische Prozesse eine zentrale Rolle spielen. Häufige primäre Formen sind:
- Minimal-Change-Glomerulonephritis (MCGN)
- Membranöse Glomerulonephritis
- Fokal-segmentale Glomerulosklerose (FSGS)
- IgA-Nephropathie (Morbus Berger)
2. Sekundäre Glomerulonephritis
Hier ist die Entzündung Folge einer anderen Grunderkrankung, etwa:
- Systemische Autoimmunerkrankungen wie Lupus erythematodes
- Infektionen (z. B. Streptokokken, Hepatitis, HIV)
- Krebserkrankungen
- Diabetes mellitus (führt langfristig zur sogenannten diabetischen Nephropathie)
Symptome – worauf man achten sollte
Eine Glomerulonephritis kann sehr unterschiedliche Beschwerden verursachen, abhängig von Verlauf und Ausprägung:
- Blut im Urin (Hämaturie) – sichtbar oder nur mikroskopisch
- Eiweiß im Urin (Proteinurie) – führt oft zu schäumendem Urin
- Wassereinlagerungen (Ödeme) – besonders an Beinen, Knöcheln, im Gesicht
- Bluthochdruck – durch gestörte Regulation des Flüssigkeitshaushalts
- Reduzierte Urinmenge
- Allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen
In schweren Fällen kann es zur akuten Nierenschwäche (akuten Niereninsuffizienz) kommen. Bei chronischem Verlauf entwickelt sich schleichend ein Funktionsverlust der Niere, der im schlimmsten Fall zur Dialysepflichtigkeit führt.
Diagnose – wie wird Glomerulonephritis festgestellt?
Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination verschiedener Untersuchungen:
- Urinuntersuchung: Nachweis von Blut, Eiweiß oder Zylindern im Urin.
- Blutuntersuchung: Bestimmung von Kreatinin, Harnstoff und Entzündungsparametern, ggf. Antikörpernachweise.
- Bildgebung: Sonografie der Nieren zur Beurteilung von Größe und Struktur.
- Nierenbiopsie: Entnahme einer kleinen Gewebeprobe zur genauen Einordnung der Glomerulonephritis und zur Planung der Therapie.
Behandlung – abhängig von Form und Verlauf
Die Therapie richtet sich nach der Art der Glomerulonephritis und dem Schweregrad der Erkrankung. Sie verfolgt in der Regel zwei Hauptziele:
- Ursachenbehandlung – z. B. Infektionen, Autoimmunprozesse oder andere Grunderkrankungen.
- Schutz und Erhalt der Nierenfunktion
Typische Therapieansätze sind:
- Entzündungshemmende Medikamente: z. B. Kortikosteroide (Kortison) oder Immunsuppressiva
- Blutdrucksenkung: vor allem mit ACE-Hemmern oder AT1-Blockern – sie schützen zusätzlich die Nierenfilter.
- Diuretika: zur Entwässerung bei Ödemen
- Protein- und salzarme Ernährung
- Dialyse: in schweren akuten Fällen oder bei fortgeschrittenem Funktionsverlust
Prognose – was sind die langfristigen Folgen?
Die Prognose hängt stark von der Art der Glomerulonephritis, dem Zeitpunkt der Diagnose und dem Therapieerfolg ab. Viele akute Formen lassen sich mit Medikamenten gut behandeln und heilen vollständig aus. Andere verlaufen chronisch und führen im Laufe der Jahre zu einem allmählichen Verlust der Nierenfunktion – insbesondere bei unzureichender Therapie oder später Diagnose.
Früherkennung und regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktion – insbesondere bei Risikopatienten – sind daher entscheidend für den langfristigen Behandlungserfolg.
©2025 Praxeninformationsseiten | Impressum